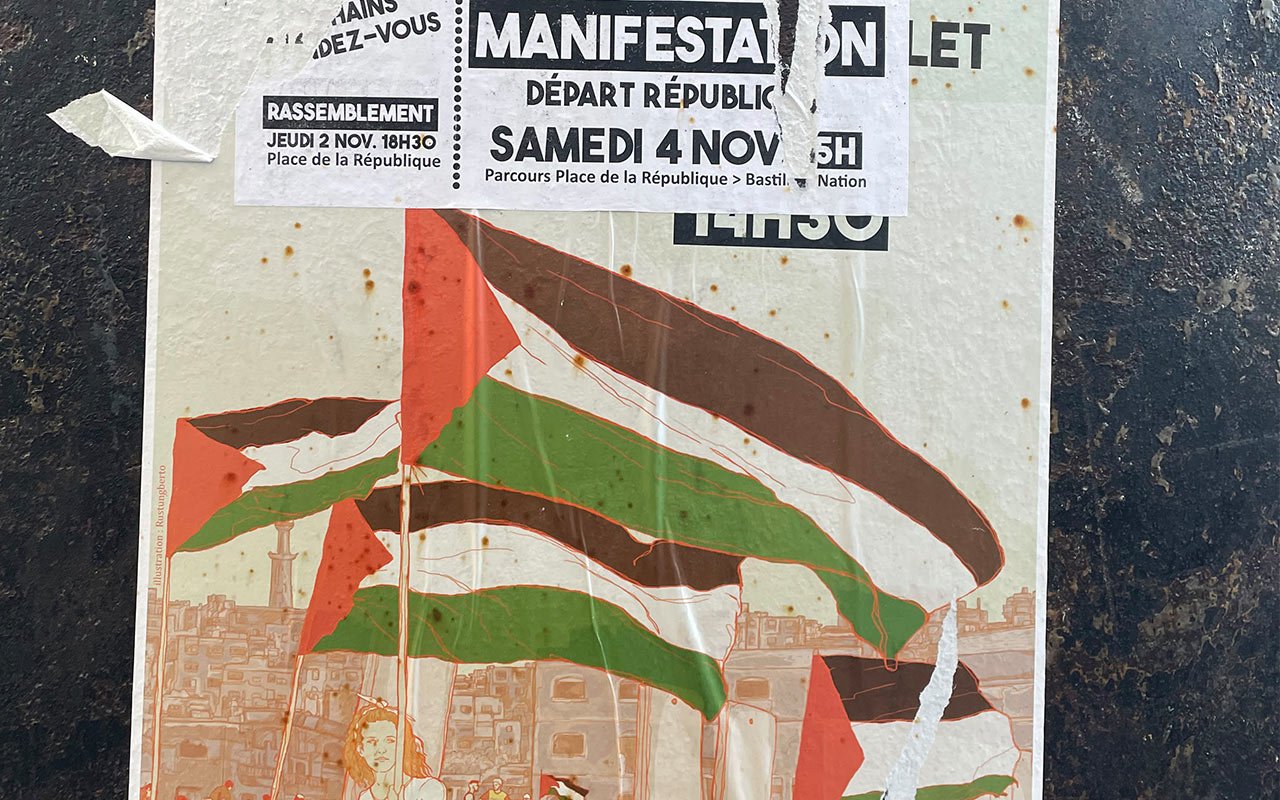Am 7. Oktober wurden die Gewalttaten der Hamas live gestreamt und aufgezeichnet. Das Material war direkt in der Welt und die entsprechenden Zielgruppen unmittelbar informiert. In diesen Momenten war schon klar, wer die kommunikative Oberhand hat und den »Gegner« vor sich hertreiben würde: Proteste gegen Israels Vorgehen in Gaza, als Reaktion auf die Pogrome, gab es schon am 8. Oktober – dabei erfolgte Israels großangelegte Reaktion erst am 23. Oktober.
Israel hatte die kommunikative Oberhand also nicht – auch wenn Empathie das folgerichtige Gefühl in intakten Gesellschaften gewesen wäre. Teilweise gab es sogar bewundernde Anerkennung. Judith Butler (eine einflussreiche Theoretikerin, vor allem im Bereich Gender Studies und Queer-Theorie) sah in den Gräueltaten einen »Akt des Widerstands« (siehe Le Figaro).
Der Wettlauf um die Köpfe fand schon zuvor in Universitätshörsälen, in den Köpfen einer globalisierten Öffentlichkeit und in den sozialen Medien statt. Das ist keine Entwicklung der jüngeren Zeit. Die Wahrnehmung Israels ist nicht plötzlich gekippt. Das sind die Früchte harter und beharrlicher Arbeit.
Das erklärt warum der Südsudan, der Jemen oder die Besetzung anderer Länder niemanden interessieren. Selbst die real existierenden Palästinenser sind in dieser Welt nur Randfiguren.
Betrachten wir die Bausteine der Niederlage. Das ist nicht in wenigen Worten erklärt. Wir brauchen also etwas Geduld und es wird ein sehr langer Text – sogar in dieser gekürzten Blogform. Einige vertiefende Informationen müssen wegfallen.
Antizionistische Propaganda ist eine Erbschaft
Der erste Befund wird möglicherweise überraschend sein und das war Teil des ursprünglichen Plans der Urheber: die Herkunft der Vorbehalte sollte tatsächlich in den Hintergrund treten.
Das ist das Grundprinzip von Propaganda. Sie wirkt nicht unmittelbar (»das ist doch Propaganda«), doch langfristig entfaltet sie Wirkung (siehe dazu hier den Artikel von Gareth Cook und die Studie von Tarcan Kumkale und Dolores Albarracín). Sie entfaltet ihre Wirkung nämlich genau dann, wenn diejenigen, die der Propaganda ausgesetzt waren, nicht mehr genau wissen, wo sie dieses oder jenes überhaupt gehört haben.
Wann hat das begonnen?
Sehr viel früher als viele annehmen.
Die narrative Niederlage wurde während des Kalten Krieges vorbereitet.
Zunächst hoffte die stalinistische Führungsklasse, dass Israel in ihr Lager – das sogenannte anti-imperialistische und sozialistische Lager – hineingezogen werden könnte. Aus diesem Grund begrüßte und feierte 1948 (beispielsweise) die Zeitung Daily Worker, die Zeitung der Kommunistischen Partei Großbritanniens, im Einklang mit der damaligen Politik der Sowjetunion, die Gründung des Staates Israel.
Der Abgesandte der Sowjetunion bei der UN sagte am 14. Mai 1947 etwa folgendes:
»Die Tatsache, dass kein westeuropäischer Staat in der Lage war, die Verteidigung der elementaren Rechte des jüdischen Volkes zu gewährleisten und es vor der Gewalt der faschistischen Henker zu schützen, erklärt die Bestrebungen der Juden, einen eigenen Staat zu gründen. Es wäre ungerecht, dies nicht zu berücksichtigen und dem jüdischen Volk das Recht abzusprechen, dieses Bestreben zu verwirklichen. Es wäre unvertretbar, diesem Volk dieses Recht zu verweigern, besonders im Hinblick auf all das, was es während des Zweiten Weltkriegs erlitten hat. Folglich muss die Untersuchung dieses Aspekts des Problems und die Ausarbeitung entsprechender Vorschläge eine wichtige Aufgabe des Sonderausschusses sein.« (Text hier archiviert verfügbar)
Die Rechte des jüdischen Volkes, einen Staat zu gründen wurden nicht hinterfragt und schon gar nicht als »Imperialismus« betrachtet. Im Gegenteil.
Der junge Staat Israel jedoch orientierte sich ab November 1951 nicht Richtung Sowjetunion und das hatte Konsequenzen. Die sowjetische Führung war nicht begeistert.
Ab 1952–53 verschärfte Stalin den »antikosmopolitischen« Kurs, der deutliche antisemitische Züge trug – am berüchtigtsten war die sogenannte »Ärzteverschwörung« in Moskau, bei der überwiegend jüdische Ärzte beschuldigt wurden, sowjetische Führungspersönlichkeiten ermorden zu wollen. Nach Stalins Tod 1953 entwickelte die Sowjetunion eine systematische antizionistische Propaganda, die Israel nicht nur als regionalen Akteur, sondern als Symbol westlicher Unterdrückung und Kolonialismus darstellte. Diese Erzählung war strategisch geschickt: Sie verknüpfte den israelisch-palästinensischen Konflikt mit dem größeren Kampf zwischen Ost und West (später zwischen dem »globalen Süden« und den vormaligen Kolonialstaaten). Israel wurde zum »Vorposten des Imperialismus« stilisiert, zu einer künstlichen, vom Westen implantierten Entität im arabischen Raum. Entscheidend dabei: Diese sowjetische Propaganda konnte auf tief verwurzelte antisemitische Traditionen zurückgreifen. Die berüchtigten »Protokolle der Weisen von Zion«, jene antisemitische Fälschung über eine angebliche jüdische Weltverschwörung, waren bereits um 1903 im zaristischen Russland entstanden – vermutlich im Umfeld des Geheimdienstes Ochrana. Russland hatte also bereits »Vorarbeit« geleistet: ein Repertoire antisemitischer Verschwörungsmythen, das nun in neuer, antiimperialistischer Verpackung reaktiviert werden konnte.
Die Sowjetunion verbreitete diese antizionistische Propaganda systematisch in der Dritten Welt, insbesondere in arabischen und afrikanischen Ländern. Israel wurde nicht als kleines Land dargestellt, das ums Überleben kämpfte, sondern als mächtiger Tentakel eines globalen imperialistischen Netzwerks – eine moderne Variante der alten antisemitischen Vorstellung von jüdischer Übermacht und Manipulation.
Diese antisemitische Welle beschränkte sich nicht auf die Sowjetunion. In der Tschechoslowakei fand 1952 der berüchtigte Slánský-Prozess statt: 14 hochrangige kommunistische Funktionäre, 11 davon jüdischer Herkunft, wurden als »Zionisten« und »Kosmopoliten« angeklagt – klassische antisemitische Codes. Rudolf Slánský selbst war Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewesen, ein überzeugter Stalinist. Das spielte keine Rolle. Elf der Angeklagten wurden hingerichtet. Die Botschaft war klar: Israel wurde zum »Vorposten des US-Imperialismus« erklärt. So entledigte sich die Tschechoslowakei – und mit ihr andere sozialistische Staaten – ihrer jüdischen Parteimitglieder, egal wie loyal sie dem Kommunismus gedient hatten.
Diese antizionistische Propaganda wurde systematisch in den Westen exportiert. Über staatliche Medien, Frontorganisationen und Einflussnahme auf westliche linke Parteien gelangten sowjetische Narrative in den Mainstream. So schafften es einzelne Artikel tatsächlich bis in die New York Times. Spartax Beglov, ein sowjetischer Journalist und Propagandist, durfte 1971 seine Thesen zum Zionismus ausführen (Link zum Artikel in der NY Times). Zwar arbeitete er sich vorgeblich an Rabbi Kahane ab (und das dürfte konsensfähig gewesen sein), aber letztendlich blieb folgende Botschaft zurück: Wer sich für Israel einsetzt, ist ein Fanatiker.
In my own country, the Soviet Union, the vast majority of Jews reject the pretenses of Zionism and consider themselves Soviet citizens.
Eine glatte Lüge. Tatsächlich durften sowjetische Juden weder ihre Religion ausüben noch nach Israel ausreisen. Hunderttausende würden in den folgenden Jahrzehnten um Ausreisegenehmigungen kämpfen.
Und weiter:
Is this what the broad American public really wants? Does it really want the relations between the world’s two greatest powers, on which world peace depends, disturbed and poisoned by a handful of Zionist fanatics whose loyalties lie not in the United States but in Israel?
Die alte antisemitische Anklage der »doppelten Loyalität« – nur neu verpackt als Sorge um den Weltfrieden. Juden, die sich für Israel einsetzen, werden zu Saboteuren amerikanischer Interessen erklärt. Das Muster ist Jahrhunderte alt, die Rhetorik modern.
Die sowjetische Propaganda war nicht auf Zeitungsartikel beschränkt. Sie operierte auch direkt vor Ort. 1973 berichtete dieselbe New York Times über einen Prozess in Paris: Die sowjetische Botschaft hatte antisemitische Agitation verbreitet (siehe hier):
A Frenchman who is general manager of the official Soviet Embassy newsletter in Paris was found guilty today of defamation, and “incitement to racial hatred and violence” for publishing an anti‐Jewish article.
Bemerkenswert: Der Verurteilte war nicht nur ein Kommunist, sondern auch stellvertretender Bürgermeister von Nanterre, einem Pariser Vorort. Die sowjetische Propaganda hatte also direkten Zugang zu lokaler Politik in Westeuropa.
the bulletin’s general manager, a Communist who is also Deputy Mayor of Nanterre, a Paris suburb.
Der Punkt war gemacht: Antizionismus war salonfähig geworden – selbst in westlichen Demokratien. Die Argumente kommen uns heute bekannt vor: Israel als Kolonialstaat, Zionisten als Fanatiker, jüdische »doppelte Loyalität« als Gefahr.
Wie wirkmächtig diese Propaganda war, zeigte sich 1976 in Entebbe. Die deutschen Terroristen Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann – Mitglieder der linksextremen »Revolutionären Zellen« – führten nach der Entführung eines Air-France-Fluges Selektionen durch: Israelis und Juden auf die eine Seite, Nichtjuden auf die andere. Deutsche Linke, kaum eine Generation nach Auschwitz, selektierten wieder Juden. Im Namen des »antiimperialistischen Kampfes«. Die Ideologie war sowjetisch, das Muster uralt.
Nach 1989, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hätte man erwarten können, dass auch ihre Propaganda verschwindet. Das Gegenteil geschah. Die antizionistischen Narrative hatten längst fruchtbaren Boden in westlichen, linken Diskursen gefunden – und lebten dort weiter, nun ohne sowjetische Steuerung, aber mit eigenem Momentum. Begriffe wie »Siedlerkolonialismus« und »Apartheid« – ursprünglich aus ganz anderen historischen Kontexten stammend – wurden auf Israel übertragen und etablierten sich als Standardvokabular progressiver Kreise.
Der Erfolg dieser narrativen Strategie lag in ihrer verführerischen Einfachheit: Komplexe historische und geopolitische Realitäten wurden in ein binäres Schema von Unterdrücker und Unterdrücktem gepresst. Die globale Ungerechtigkeit? Findet man nicht in Russlands Gulags, nicht in Chinas Lagern, nicht in Nordkoreas Hungersnöten – nein, sie wird praktisch von Israel repräsentiert. Ein Land von der Größe Hessens als Symbol allen Übels. Alles schön einfach.
Für die heutige progressive Linke, die sich als Anwältin marginalisierter Gruppen versteht, ist Antizionismus eine Quelle moralischen Kapitals geworden – ein Erbe der sowjetischen Propaganda, das sie oft nicht als solches erkennt. Israel wird zum Symbol all dessen, was man ablehnt: Kolonialismus, westliche Hegemonie, Rassismus.
Der Antizionismus kommt nun als moralische, ja tugendhafte Ideologie daher. Es geht ja vorgeblich nicht um Eigeninteressen, sondern um Gerechtigkeit. Nicht um Macht, sondern um Menschenrechte. Nicht um Hass, sondern um Solidarität mit den Unterdrückten.
Nachdem große Teile der modernen Linken nun jahrzehntelang die Aufklärung und ihre Werte kritisch hinterfragt haben – Wahrheit, Vernunft, Universalismus, Menschenrechte wurden als »westliche Konstrukte« dekonstruiert1 und relativiert – blieb erstaunlich wenig übrig, worauf man ein gemeinsames Wertegerüst aufbauen konnte.
Die Tugenden der Aufklärung? Kritisiert als eurozentrisch. Universelle Menschenrechte? Hinterfragt als koloniales Konzept. Objektive Wahrheit? Aufgelöst in subjektive Perspektiven. Wenn aber all diese Werte wackeln – was bleibt dann noch als gemeinsamer moralischer Nenner?
Der Antizionismus wurde zur letzten verbliebenen »Tugend«, um die sich diejenigen versammeln konnten, die zuvor alles andere dekonstruiert hatten.
Wer also heute vorgibt, die Mechanik des Nahostkonflikts durchschaut zu haben, sollte sich fragen: Sind das wirklich eigene Einsichten – oder nur aufgewärmte sowjetische Propaganda aus den 1960ern und 70ern? Die Argumente klingen verblüffend vertraut, weil sie es sind.
Proteste wie »Rheinmetall entwaffnen« sind kein Zufall. Sie richten sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und an Israel – zwei Demokratien, die sich gegen autoritäre Aggressoren verteidigen. Gegen wen richten sie sich nicht? Gegen Russland, Iran, Hamas, Hisbollah. Das funktioniert nur, wenn man die »gegen den westlichen Imperialismus«-Pille geschluckt hat – ein sowjetisches Narrativ, das den Kalten Krieg überlebt hat. Unnötig anzumerken, dass man sich damit gegen Freiheit und Demokratie ausspricht. Denn was haben die »antiimperialistischen« Regime im Angebot? Theokratie, Diktatur, Unterdrückung. Aber das stört offenbar nicht, solange man auf der vermeintlich richtigen Seite der Geschichte steht.
Der Handshake mit dem Islamismus
Und das auch das muss verblüffen: Begriffe wie Befreiung, Antikolonialismus oder Widerstand, die, wie wir gesehen haben, ursprünglich aus linken und säkularen Bewegungen stammen, werden heute auch von islamistischen Gruppen verwendet – und finden damit Anklang bei progressiven Kreisen im Westen. Wie konnte es dazu kommen?
In den 1950er bis 1970er Jahren waren antikoloniale Kämpfe in Afrika, Asien und Lateinamerika oft von linken, sozialistischen oder marxistischen Ideologien geprägt. Ob Frantz Fanon in Algerien, die Sandinisten in Nicaragua oder verschiedene afrikanischen Befreiungsbewegungen – sie alle sprachen von der Überwindung kolonialer Unterdrückung, von nationaler Selbstbestimmung und sozialer Gerechtigkeit.
Diese Bewegungen waren in der Regel säkular ausgerichtet. Religion spielte entweder keine Rolle oder wurde sogar, im Sinne des Kommunismus, als »Opium des Volkes« betrachtet. Der Feind war klar definiert: Kolonialismus, Imperialismus, Kapitalismus. Die Vision: eine gerechte, also dann sozialistische, Gesellschaft.
Die Sowjetunion unterstützte viele dieser Bewegungen strategisch und verbreitete eine antiwestliche, antiimperialistische Rhetorik weltweit. Palästinensische Gruppen wie die PLO waren in dieser Zeit eng mit linken, säkularen Befreiungsbewegungen verbunden. Jassir Arafat trug keine religiösen Symbole, sondern eine Kalaschnikow und sprach die Sprache des revolutionären Nationalismus.
Was war der verschmelzende Wendepunkt?
Ein entscheidender Moment war die iranische Revolution 1979. Hier gelang es erstmals, eine Revolution gegen westlichen Einfluss (den Schah, der von den USA unterstützt wurde) unter islamischer Führung durchzuführen. Ayatollah Khomeini adaptierte geschickt antikoloniale und antiimperialistische Rhetorik, verband sie aber mit islamischer Ideologie.
Plötzlich war es möglich, Befreiung religiös im islamistischen Sinne zu codieren. Der Unterdrücker war weiterhin der Westen, aber die Alternative war nicht mehr der Sozialismus, sondern ein islamischer G-ttesstaat. Begriffe wie Befreiung und Widerstand wurden umgedeutet – sie bedeuteten nun Befreiung von westlicher Dekadenz und Rückkehr zu religiösen Werten.
In den 1980er und 1990er Jahren scheiterten viele säkulare, sozialistische Regime im Nahen Osten. Nassers panarabischer Sozialismus in Ägypten, die Baath-Parteien (deren Vorbild tatsächlich im Faschismus zu verorten waren) in Syrien und Irak – sie alle enttäuschten durch Korruption, Autoritarismus und wirtschaftliches Versagen.
In diesem Vakuum gewannen islamistische Bewegungen an Boden. Sie boten eine Alternative, die nicht vom Westen kam und nicht gescheitert war. Die Muslimbruderschaft, die Hamas (gegründet 1987) und später Al-Qaida füllten den Raum.
Entscheidend: Sie übernahmen dabei die Sprache antikolonialer Befreiung. Die Hamas bezeichnet sich als Widerstandsbewegung, die Hisbollah spricht von der Befreiung des Libanon, der Iran von der Befreiung Palästinas. Die Begriffe blieben, aber die Bedeutung verschob sich fundamental.
Parallel dazu entwickelte sich im westlichen Universitätsbetrieb die postkoloniale Theorie. Denker wie Edward Said (»Orientalismus«, 1978) analysierten, wie der Westen den Orient konstruiert und dominiert hatte. Diese Kritik war ursprünglich differenziert und aufklärerisch motiviert.
Doch in ihrer Popularisierung entstand oft ein vereinfachtes Weltbild: Hier der unterdrückende Westen, dort die unterdrückten »Anderen«. Jede Bewegung, die gegen westliche Interessen kämpfte, konnte nun als progressiv gelten – unabhängig davon, welche Werte sie vertrat. Das war der Zeitpunkt des Handshakes: Linke im Westen, die für LGBTQ-Rechte, Feminismus und Säkularismus eintreten, solidarisieren sich mit islamistischen Bewegungen, die genau diese Werte fundamental ablehnen. Klar, wenn man den Westen, Israel oder die USA als Hauptgegner sieht, wird jede Kraft, die ebenfalls dagegen kämpft, zum potenziellen Verbündeten. Die konkrete Ideologie wird zweitrangig gegenüber der gemeinsamen Frontstellung. Dann gilt (sehr vereinfacht gesagt) in der modernen Identitätspolitik: Je stärker eine Gruppe als unterdrückt wahrgenommen wird, desto mehr moralische Autorität besitzt sie. Muslime werden im Westen oft als diskriminierte Minderheit gesehen – zu Recht, was Rassismus und Islamophobie angeht. Aber diese berechtigte Sensibilität führt manchmal zu einer problematischen Zurückhaltung. Kritik an islamistischen Ideologien kann schnell als islamophob abgewehrt, selbst wenn diese Kritik von säkularen Muslimen oder Ex-Muslimen kommt, die unter diesen Ideologien litten oder leiden.
Eine gewisse Romantik gehört auch dazu. Viele westliche Progressive projizieren ihre eigenen Werte auf islamistische Bewegungen. Sie hören »Befreiung« und denken an soziale Gerechtigkeit, obwohl gemeint ist: Befreiung von säkularem Recht zugunsten der Scharia. Sie hören »Widerstand« und denken an Unterdrückte, die sich wehren, übersehen aber das theokratische Endziel. Alles, was aus dem Westen kommt, wird verdächtig, alles, was sich dagegen richtet, wird unkritisch verteidigt. Selbstkritik der eigenen Kultur wird zur einzig erlaubten Form der Kritik.
Hamas-Vertreter geben im Westen Interviews über »Freiheit« und »Gerechtigkeit«, während ihre Charta zur Vernichtung Israels aufruft und ihre Herrschaft in Gaza Frauen und Andersdenkende brutal unterdrückt(e).
Der israelisch-palästinensische Konflikt wurde zum zentralen Schauplatz dieser ideologischen Verschiebung. Während die PLO früher säkular-nationalistisch argumentierte, übernahm die 1987 gegründete Hamas die Führung mit explizit islamistischer Agenda.
Trotzdem wird Hamas im Westen oft nur als »Widerstandsbewegung« wahrgenommen, nicht als Ableger der Muslimbruderschaft mit dem erklärten Ziel eines islamischen Staates. Die antikoloniale Rhetorik verdeckt die theokratische Realität.
Abschreckung – Keine bis wenig Empathie
Soweit zu einer sehr erfolgreichen Erzählung. Kommen wir zu einer Darstellung, die alles andere als erfolgreich war.
Das, was Israels Lebensversicherung war und ist, stellte sich als kommunikative Katastrophe heraus. Abschreckung hat Israels Feinde lange davon abgehalten, eine großflächige Invasion zu planen. Der Preis für eine solche Aktion sollte möglichst hoch sein. Und Abschreckung geschah militärisch wie kommunikativ. Die Botschaft sollte in aller Klarheit lauten: »Wir sind stark, wir sind unbesiegbar, wir lassen uns nicht unterkriegen. Versuch’s nicht.«
Diese Strategie war militärisch und sicherheitspolitisch sinnvoll. Das Wort »sinnvoll« ist sogar noch viel zu schwach. Doch in der Welt der öffentlichen Meinung wirkte sie verheerend.
Ein anderes Beispiel: Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome, das Tausende Leben rettete, wurde zum PR-Problem. Während Hamas-Raketen abgefangen wurden und dadurch weniger Israelis starben, schlugen israelische Gegenmaßnahmen in dicht besiedeltem Gaza ein – mit entsprechenden Bildern. Die technologische Überlegenheit, die Leben rettet, wurde zum Beweis der Asymmetrie und damit zur Anklage.
Stärke allein generiert keine Sympathie. Im Gegenteil: In einer medialisierten Welt, in der David-gegen-Goliath-Erzählungen besonders wirkungsvoll sind, spielte Israel unfreiwillig die Rolle des übermächtigen Goliath. Bilder von hochmodernen israelischen Waffen neben den provisorischen Raketen palästinensischer Gruppen (teilweise ja auch so von Israel berichtet) verstärkten diesen Eindruck noch.
Die Abschreckungsstrategie hatte noch einen weiteren fatalen Nebeneffekt: Sie machte Israel emotional unzugänglich (für nichtjüdische Beobachter in erster Linie). Während pro-palästinensische2 Narrative stark auf emotionale Resonanz setzten – Bilder von Leid, Vertreibung und Widerstand –, präsentierte sich Israel vorwiegend als kühler, rationaler Akteur. Rationalität ist fein, aber Menschen treffen Entscheidungen nicht nur rational.
Ja, Ausnahmen gab und gibt es, aber insgesamt fehlt eine große eigene Erzählung.
Das Versagen der Social Media Strategie
In den sozialen Medien wiederholten und wiederholen israelsolidarische Gruppen – ob offiziell oder informell – einen klassischen Kommunikationsfehler: Sie predigen zur eigenen Gemeinde.
Die Wahrheit ist unbequem: Auch die gepriesenen pro-israelischen Influencer spielen außerhalb der eigenen Blase kaum eine Rolle. Es fehlen Stimmen, die emotional Menschen erreichen, die noch unentschieden sind oder Israel kritisch gegenüberstehen. Die Selbstvergewisserung innerhalb der Community mag gut und wichtig sein – aber wenn es darauf ankommt, nach außen zu wirken, bleibt die Wirkung marginal.
Jüdische und pro-israelische Influencer erreichten vor allem jene, die bereits überzeugt waren. Man blieb in der eigenen Echokammer gefangen – ohne es zu bemerken. Likes und Kommentare suggerierten Reichweite, doch tatsächlich bewegte man sich im Kreis.
Der Kontrast zur Gegenseite könnte kaum größer sein. Während anti-israelische Narrative geschickt verschiedene Zielgruppen ansprachen – antikoloniale Bewegungen, Menschenrechtsaktivisten, progressive Studierende, religiöse Gemeinschaften, sogar queere und feministische Kreise –, konzentrierte sich die Israelsolidarität darauf, immer dieselben Argumente vor immer demselben Publikum zu wiederholen.
Das Problem war nicht mangelnde Aktivität. Es wurde gepostet, kommentiert, geteilt – teilweise rund um die Uhr. Das Problem war die fehlende strategische Ausrichtung: Wen wollte man eigentlich erreichen? Und wie?
Fakten und Zahlen, so wichtig sie auch sind, verlieren ihre Wirkung, wenn sie nicht in eine emotionale und moralische Erzählung eingebettet sind, die auch außerhalb der eigenen Unterstützerkreise resoniert. Während die Gegenseite mit Bildern, persönlichen Geschichten und moralischen Appellen arbeitete, setzte man auf Infografiken über Raketenbeschuss und historische Zeitleisten – wichtig für die eigene Gemeinde, irrelevant für Unentschlossene.
Ein Beispiel: Nach dem 7. Oktober fluteten pro-israelische Accounts Social Media mit Fakten über Hamas-Terror, mit Aufrufen zur Solidarität, mit Symbolen wie der israelischen Flagge. All das erreichte Menschen, die bereits solidarisch waren. Aber was erreichte die Studentin in Berlin, die gerade erst anfing, sich mit dem Konflikt zu beschäftigen? Was erreichte den linksliberalen Journalisten, der zwischen »beide Seiten haben Unrecht« schwankte? Die Antwort: Nichts. Oder schlimmer: das Falsche.
Denn während die pro-israelische Seite Fakten lieferte, lieferte die Gegenseite Emotion. TikTok-Videos von weinenden palästinensischen Kindern, Instagram-Stories mit persönlichen Schicksalen, Hashtags wie #FreePalestine, die Zugehörigkeit zu einer globalen Bewegung suggerierten. Das ist keine Erfindung, sondern Kommunikations-Grundwissen: Menschen entscheiden emotional, nicht rational. Erst kommt das Gefühl, dann die Rechtfertigung.
Hinzu kam ein strukturelles Problem: Viele pro-israelische Influencer wirkten – bewusst oder unbewusst – als würden sie für Israel sprechen, nicht mit dem Publikum. Sie erklärten, rechtfertigten, verteidigten. Das ist eine Defensivhaltung, und Defensive gewinnt keine neuen Herzen.
Die Gegenseite dagegen lud ein: »Komm zu uns, wir sind die Guten, wir kämpfen für Gerechtigkeit.« Das ist inklusiv, empowernd, moralisch aufgeladen. Die pro-israelische Botschaft dagegen: »Ihr versteht das nicht, lasst mich euch erklären.« Das ist exklusiv, belehrend, distanziert.
Ein weiterer Fehler: Man unterschätzte die Macht der Ästhetik. Anti-israelische Inhalte waren oft visuell ansprechend, emotional gestaltet, teilbar. Pro-israelische Inhalte? Oft textlastig, nüchtern, »altbacken«. In einer Welt, in der Aufmerksamkeitsspannen bei Sekunden liegen, ist das fatal.
Schließlich: Man reagierte nur, statt zu agieren. Immer dann, wenn es in Nahost eskalierte, explodierten die Aktivitäten. Doch dazwischen? Funkstille. Die Gegenseite dagegen arbeitete kontinuierlich: Sie baute Narrative auf, pflegte Communities, schuf langfristige Verbindungen. Wenn dann die Krise kam, war das Fundament bereits gelegt.
Das Ergebnis dieser Strategie – oder besser: Nicht-Strategie? Man bestärkte die eigenen Leute, gewann aber niemanden hinzu. Schlimmer noch: Für Außenstehende wirkte die Israelsolidarität oft als elitärer Club, der sich abschottet und die Welt belehren will.3
Das ist bitter, aber es ist die Realität. Und solange sich das nicht ändert – solange man nicht lernt, über die eigene Blase hinaus zu kommunizieren, emotional zu erzählen statt nur zu argumentieren, inklusiv zu wirken statt defensiv –, wird sich am narrativen Ungleichgewicht nichts ändern.
Nicht zu vergessen: Große Gruppen können nur mit Emotionen erreicht werden – nicht mit rationalen Erörterungen. Das ist eine Grundlage für die Steuerung von »Massen«: Angst, Wut, Aufregung. Es gibt einen Grund, warum es keine Friedensdemonstrationen für einen Frieden in Gaza gibt, sondern immer ausschließlich gegen den Staat Israel richten. Große Gruppen können nur mit einfachen Ideen erreicht werden. Auf keiner Demo kann jemand von einem »sowohl – als auch« skandieren.
Empathie
Hier liegt vielleicht der größte strategische Fehler: Israelsolidarität versäumte es systematisch, Empathie für die eigenen Positionen und die Menschen in Israel aufzubauen, lange bevor die Krise eskalierte. Empathie entsteht nicht über Nacht, sie muss über Jahre und Jahrzehnte kultiviert werden. Sie entsteht durch Geschichten, durch menschliche Verbindungen, durch das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und durch geteilte Werte.
Stattdessen konzentrierte sich Israel darauf, seine Positionen zu rechtfertigen, wenn bereits Konflikte tobten. Doch in Krisenzeiten sind die Fronten bereits verhärtet. Die Zeit für Empathie-Aufbau ist die friedliche Zeit, nicht der Krieg. Es hätte in ruhigeren Phasen systematisch daran gearbeitet werden müssen, seine Geschichte, seine Sorgen, seine Hoffnungen einer breiteren Weltöffentlichkeit zu vermitteln: als Geschichten von und über Menschen. Geschichten und Gestalten gab und gibt es in großer Zahl. Kleine Geschichten der Begegnung, des multikulturellen Zusammenlebens, der Empathie und von zwischenmenschlichen Beziehungen. Gelungenen und misslungenen. Diese sind vielleicht sogar interessanter.
Während dieser Zeit hat die Gegenseite nicht geschlafen und fleißig agiert, während pro-israelische Akteure (gerade in Deutschland) stets nur reagiert haben statt für Empathie zu werben. Viele Initiativen der deutschen Israelsolidarität bestanden darin, gegen einzelne Personen vorzugehen, die sich für die andere Seite (oder vermeintlich) engagierten.
Empathiefördernd war das nicht, aber es sicherte zahlreiche Schulterklopfer aus dem eigenen Team. Folge war vielleicht auch eine Art von spiralförmiger Beschleunigung und die Integration von Menschen, die nicht für das stehen, was Israel eigentlich ist: Eine moderne Demokratie (die vermutlich oder hoffentlich auch resilient gegen die derzeitige Regierung ist), in der verschiedene Ethnien zusammenspielen. Man könnte das Gefühl gewinnen, viele Aktivisten hätten das Gefühl, bei den Diskussionen käme eine Waage zum Einsatz: Einer extremen Position wird eine andere extreme Gegenposition gegenübergestellt.
Der 7. Oktober
Der 7. Oktober 2023 war nicht nur eine menschliche und militärische Katastrophe, sondern auch das narrative Ende der Abschreckungsstrategie. Die Bilder des Angriffs der Hamas zeigten der Welt: Israel ist verwundbar. Die sorgfältig aufgebaute Erzählung von der unbesiegbaren Militärmacht zerbrach in wenigen Stunden. Der nicht endende Krieg gegen Gaza unterstreicht dieses Bild ebenfalls.
Plötzlich war Israel nicht mehr der übermächtige Goliath, sondern selbst Opfer eines brutalen Angriffs. Doch das narrative Fundament war bereits so erschüttert, dass selbst diese dramatische Verschiebung nicht ausreichte, um die öffentliche Meinung nachhaltig zu beeinflussen. Zu stark waren die etablierten Narrative, zu tief die Skepsis gegenüber israelischen Positionen. Tatsächlich war ja dann sogar das Gegenteil der Fall. Antizionismus gilt jetzt als progressive Haltung. Was folgte, war eine Täter-Opfer-Umkehr mit atemberaubender Geschwindigkeit. Jüdische Studenten in Harvard, die nichts mit israelischer Politik zu tun hatten, mussten sich rechtfertigen oder verstecken. Synagogen wurden angegriffen. Jüdische Geschäfte markiert. In Berlin, Paris, London waren Juden nicht mehr sicher – nicht wegen rechtsextremer Angriffe (die gab es auch), sondern wegen einer vermeintlich progressiven Bewegung, die Free Palestine skandierte und dabei jeden erkennbaren Juden als legitimes Ziel betrachtete. Antizionismus wurde nicht nur zur progressiven Haltung – er wurde zur moralischen Pflicht. Wer nicht lautstark genug Israel verurteilte, galt als Komplize. Jüdische Künstler wurden ausgeladen. Israelische Wissenschaftler boykottiert. Und all das geschah unter dem Banner von Gerechtigkeit und Menschenrechten.
Die die Geiseln, die Hamas in den Gaza-Streifen verschleppt hatte – darunter Kinder, Frauen, ältere Menschen –, wurden kaum zum Kristallisationspunkt internationaler Empörung. Während bei anderen Konflikten jede Geiselnahme zu globalem Aufschrei führt, blieben gelbe Schleifen und Solidaritätsaktionen weitgehend aus. Manche progressive Kreise relativierten und entsorgten Plakate, die an die Geiseln erinnerten und erinnern. Die Botschaft war klar: Selbst als unmittelbare, unschuldige Opfer zählten Israelis nicht – oder nicht genug.
Eine zentrale Rolle spielten soziale Medien. Auf TikTok und Instagram verbreiteten sich Simplifizierungen, Falschinformationen und offen antisemitische Narrative mit viraler Geschwindigkeit. Junge Menschen, die weder die Geschichte des Konflikts kannten noch je einen Israeli oder Palästinenser getroffen hatten, positionierten sich lautstark – auf Basis von 60-Sekunden-Videos. Die algorithmische Logik dieser Plattformen tat ihr Übriges: Emotionale, vereinfachte Inhalte (»Völkermord!«) performten besser als differenzierte Analysen. Die Komplexität eines 75 Jahre alten Konflikts passte nicht in ein Story-Format. Also wurde sie weggelassen.
Zum Vergleich: Russlands Krieg in der Ukraine, die saudische Bombardierung des Jemen – all das löste nicht annähernd die Mobilisierung aus wie Israels Krieg in Gaza. Die Frage ist nicht, ob Israel kritisiert werden darf. Die Frage ist, warum nur Israel mit dieser Obsession kritisiert wird.
Der 7. Oktober sollte ein Wendepunkt sein. Stattdessen wurde er zum Katalysator: für mehr Hass, mehr Gewalt, mehr Vereinfachung. Israel hatte verloren – nicht militärisch, aber narrativ. Und mit Israel verloren auch die Werte, die einst als progressiv galten: universelle Menschenrechte, Verhältnismäßigkeit, die Ablehnung kollektiver Schuld.
Der 7. Oktober bewies nicht nur Israels Verwundbarkeit. Er bewies auch, wie tief der Antisemitismus – getarnt als Antizionismus – in progressive Kreise eingesickert war.
Was muss jetzt folgen?
Was hätte anders gemacht werden können? Und was kann noch geändert werden?
Proaktive Empathie-Arbeit.
Proisraelische Akteure müssen lernen, die Geschichte nicht nur als Sicherheitsnarrativ zu erzählen, sondern als menschliche Geschichte. Zu berichten gäbe es viel: Die Geschichten von Überlebenden der Schoah, die einen neuen Anfang suchten. Von Flüchtlingen aus arabischen Ländern, die alles verloren und in Israel eine neue Heimat fanden. Von Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollen – Israelis und Palästinenser gleichermaßen. Diese Geschichten müssen erzählt werden, bevor die nächste Krise ausbricht. Nicht als Reaktion auf Angriffe, sondern als kontinuierliche Arbeit. Sympathie aufzubauen ist ein langfristiges Projekt, das Ruhe, Zeit und Begegnungen braucht – Dinge, die in einem Dauerkonflikt Mangelware sind.
Vielleicht durch Austauschprogramme, die Menschen nach Israel bringen – nicht nur in politische Briefings, sondern in Wohnzimmer, auf Märkte, in Cafés.
Wie sichtbar ist israelische Kultur heute? Filme, Musik, Literatur, Kunst – die die Vielfalt dieser Gesellschaft zeigen?
Haben israelisch-palästinensische Koexistenzprojekte Plattformen erhalten? Diese Projekte gab und gibt es, aber sie blieben bisher nahezu unsichtbar.
Jüdisches Leben in Europa sollte eigentlich selbstverständlich sein und sichtbar – keine exotische Besonderheit, sondern als integraler Teil der Gesellschaft. Nach dem 7. Oktober wurde jeder Fortschritt in dieser Hinsicht zurückgedreht.
Echte Meinungsvielfalt – und den Mut zur Selbstkritik
Statt nur mit Gleichgesinnten zu sprechen, müssen proisraelische Akteure lernen, auch kritische Stimmen ernst zu nehmen und in den Dialog zu treten. Das bedeutet nicht, jede Kritik nickend zu akzeptieren, aber es bedeutet, zu verstehen, woher sie kommt und wie sie entstanden ist.
Das heißt konkret:
Anerkennen, dass nicht jede Kritik an israelischer Politik antisemitisch ist.
Selbstkritik zulassen: Ja, es gibt problematische Entwicklungen in der Siedlungspolitik, Extremismus, Korruption. Man kann diese Probleme benennen, ohne die Existenzberechtigung Israels infrage zu stellen.
Gegenstimmen nicht als »Verräter« brandmarken, wenn sie Israel kritisieren – sondern diese Stimmen als Teil der notwendigen Debatte verstehen.
Den Unterschied klarmachen zwischen Kritik (legitim) und Dämonisierung (antisemitisch).
Gleichzeitig: Klare Grenzen setzen. Wer Israels Existenzrecht leugnet, Hamas-Terror rechtfertigt oder Juden kollektiv haftbar macht, steht außerhalb des legitimen Diskurses. Diese Grenze muss klar sein – und verteidigt werden.
Narrative Komplexität
Die Welt ist nicht schwarz-weiß, und proisraelische Akteure müssen lernen, diese Komplexität zu vermitteln, ohne sich in Relativismus zu verlieren. Es ist möglich, sowohl israelisches als auch palästinensisches Leid anzuerkennen, ohne die eigene Position aufzugeben. Das bedeutet: Ja, Palästinenser haben gelitten und leiden. Gleichzeitig: Kontext liefern. Warum gab es 1948 einen Krieg? Weil fünf arabische Armeen einen gerade gegründeten Staat auslöschen wollten. Warum gibt es auch Besatzung? Weil nach mehreren Kriegen Sicherheit notwendig wurde.
Anerkennen, dass es auf beiden Seiten Extremisten gibt – aber nicht mit falscher Äquivalenz arbeiten. Eine demokratische Gesellschaft mit freier Presse und unabhängigen Gerichten ist nicht dasselbe wie eine Terrororganisation, die Homosexuelle hinrichtet.
Die Vision einer Zweistaatenlösung hochhalten – auch wenn sie derzeit unerreichbar scheint. Zeigen, dass es ein Danach geben könnte, in dem beide Völker in Würde leben. Möglicherweise nebeneinander und nicht miteinander.
Universelle Werte konsequent vertreten – für alle
Ein zentrales Problem ist die Doppelmoral. Israel wird mit Standards gemessen, die sonst nirgends angelegt werden. Die Antwort darauf ist nicht, diese Standards abzulehnen, sondern sie universell einzufordern.
Menschenrechte sind unteilbar. Sie gelten für Israelis und Palästinenser, für Frauen in Gaza und schon ganz selbstverständlich für Menschen mit ganz eigenen Lebensentwürfen in Israel.
Wer »Befreiung« fordert, muss sagen: Befreiung in welche Richtung? Für Demokratie oder Theokratie? Für Pluralismus oder religiösen Zwang?
Progressive Werte konsequent einfordern – auch von palästinensischen Akteuren. Wer die Hamas unterstützt, kann nicht für LGBTQ-Rechte demonstrieren. Wer Selbstmordattentate bejubelt, kann sich nicht auf Menschenrechte berufen.
Den Unterschied klarmachen zwischen antikolonialer Befreiung (gut) und totalitären Bewegungen in antikolonialem Gewand (schlecht).
Die akademische und mediale Hegemonie herausfordern
Der Kampf um die öffentliche Meinung wurde auch deshalb verloren, weil proisraelische und jüdische Stimmen in Universitäten, Medien und Kulturinstitutionen marginalisiert wurden. Das muss sich ändern.
Konkret könnte das bedeuten: Investition in Bildungsarbeit. Lehrstühle, Stipendien, Publikationen, die differenzierte Perspektiven fördern.
Medienkompetenz stärken. Menschen befähigen, Propaganda zu erkennen – egal von welcher Seite.
Plattformen schaffen für israelische Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler – nicht nur als Verteidiger, sondern als eigenständige Stimmen.
Der Verfall der liberalen Demokratien
Die Überschrift ist etwas pathetisch. Aber hier liegt tatsächlich die eigentliche, noch größere Herausforderung: Selbst wenn eines Tages die Waffen in Israel und Palästina schweigen – selbst wenn es gelingt, nebeneinander in Frieden zu leben –, die antiwestlichen, antiaufklärerischen Haltungen innerhalb der westlichen Gesellschaften werden bleiben.
Das ist die eigentliche existenzielle Bedrohung. Nicht die Hamas. Nicht Iran. Nicht äußere Feinde. Sondern die innere Erosion der Werte, die freie, liberale Demokratien ausmachen:
- Das Vertrauen in Vernunft und rationale Debatte
- Der Glaube an universelle Menschenrechte
- Die Ablehnung kollektiver Schuld
- Die Fähigkeit, Komplexität auszuhalten statt in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen
- Der Mut, Wahrheit über Ideologie zu stellen
Wenn diese Werte kollabieren, ist Israel nur das erste Opfer – nicht das letzte. Denn die Logik, die heute gegen Israel angewandt wird – doppelte Standards, Täter-Opfer-Umkehr, Relativierung von Gewalt, Ablehnung universeller Prinzipien –, wird sich gegen alles richten, was der Westen einmal war.
Die Verteidigung Israels ist deshalb nicht nur eine Frage jüdischen Überlebens. Sie ist eine Frage westlicher Selbstbehauptung. Wer Israel aufgibt, gibt die Aufklärung auf. Wer die Augen verschließt vor linkem Antisemitismus (rechtem natürlich auch), öffnet die Tür für Totalitarismus.
Die Israelsolidarität hat den Kampf um die öffentliche Meinung verloren, weil sie diesen Kampf falsch verstanden hat. Man dachte, es gehe um Fakten und Stärke, dabei ging es auch um Emotionen und Empathie. Man dachte, es gehe darum, die eigenen Anhänger zu mobilisieren, dabei ging es darum, neue zu gewinnen. Aber hier liegt auch eine Illusion: Es reicht nicht, »bessere Geschichten« zu erzählen. Geschichten können Herzen erreichen – aber wenn die Institutionen erobert sind, wenn die Studentenschaft ideologisch geschlossen ist (jedenfalls in Teilen), wenn die Medien nur eine Perspektive zulassen, dann verpuffen auch die besten Geschichten.
Was es braucht, ist eine kulturelle Gegenbewegung:
Bildungsreformen, die kritisches Denken statt ideologische Indoktrination zulassen. Medien, die Komplexität zulassen statt Simplifizierung belohnen. Eine Zivilgesellschaft, die den Mut hat, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Eine Politik, die klare Kante zeigt gegen Antisemitismus – egal woher er kommt. Und ja: Geschichten, die Menschen erreichen, bewegen, zum Nachdenken bringen.
Am Ende siegen nicht die stärkeren Waffen, sondern die besseren Geschichten – aber nur, wenn es auch Räume gibt, in denen diese Geschichten gehört werden können.
Frieden vor Ort ist nur möglich, wenn beide Seiten Kompromisse machen und wenn die internationale Gemeinschaft konstruktiv unterstützt statt zu befeuern.
Letztendlich, das sind natürlich große Worte, wird das für alle liberalen Demokraten entscheidend sein. Diejenigen, die sich gestern und heute haben mobilisieren lassen, werden morgen in Entscheiderpositionen sitzen und mitbestimmen über den Kurs unserer Demokratien.
Einige dekoloniale Theoretiker:innen (z. B. Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos oder Achille Mbembe) argumentieren, dass die universellen Menschenrechte historisch eng mit der europäischen Aufklärung und der Kolonialgeschichte verbunden sind. ↩︎
Kleiner Hinweis: Damit sind nicht Menschen gemeint, die für Empathie und Frieden werben. Hier sind diejenigen gemeint, die gegen Israel agitieren. ↩︎
Es wäre sicher interessant darüber zu schreiben, wie schwer die Kontaktaufnahme mit lokalen Deutsch-Israelischen Gesellschaften fällt. ↩︎