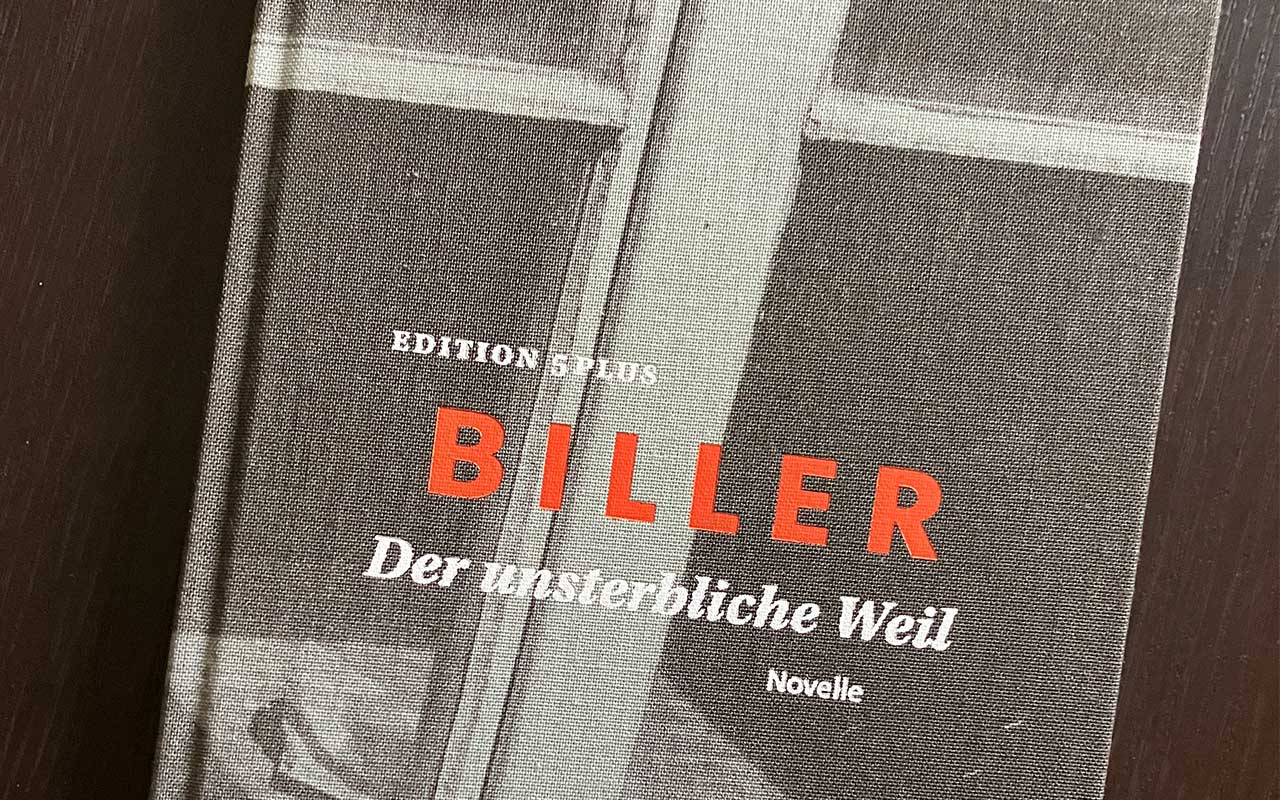Ein neues Buch erscheint fast beiläufig – und doch mit einer Wucht, die lange nachhallt. »Der unsterbliche Weil« von Maxim Biller ist keine bloße Novelle über den tschechisch-jüdischen Schriftsteller Jiří Weil, sondern ein intertextuelles Spiel, das dessen Werk neu zum Leuchten bringt.
Jiří Weil ist keine fiktive Figur. Die Stadt in der er sich bewegt, ist keine fiktive. Wir begleiten Weil in poetischer Sprache durch Prag und seine Lebensgeschichte. Aber nicht nur die Sprache macht diesen Text bedeutsam. Die Meisterschaft Billers liegt im intertextuellen Spiel mit Weils Texten.
Der Reihe nach.
Auf der Erzählebene geht es um die Lebensgeschichte eines Mannes, der die beiden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts kennenlernen musste. Er selbst war Kommunist und doch Kritiker des Stalinismus und so sollte auch er 1935 sterben - jedenfalls nach dem Willen der Partei. Nur weil sein linientreuer Schriftstellerfreund Julius Fučík intervenierte, wurde er nicht hingerichtet. Weil schrieb später einen dokumentarischen Roman über ihn und wird im Büchlein Billers zum Gesprächspartner Weils. Weil wurde verbannt, kehrte zurück und geriet dann unter die deutsche Besatzung. Als Jude überlebte Weil die deutsche Besatzung durch eine List: einen vorgetäuschten Selbstmord. Dies jedenfalls in der Novelle Billers.
Nach der Befreiung des Landes blieb Weil ein Außenseiter und durfte nicht als Schriftsteller arbeiten. Sein Roman über die Schoah in Prag wurde verboten. Es passte nicht zur Erzählung der wehrhaften tschechischen Bevölkerung. Billers Text setzt zu einem Zeitpunkt ein, zu dem es möglich sein könnte, dass Weil wieder in den Schriftstellerverband aufgenommen werden könnte. Seine Arbeit im Jüdischen Museum Prags könnte er dann hinter sich lassen. Jedenfalls für die Lebenszeit, die ihm noch geblieben ist. Einen Teil seiner Arbeit für das Museum kennen jene, die sich in Prag die Pinkas Synagoge angeschaut haben. An den Wänden der Synagoge stehen die Namen der tschechischen Opfer der Schoah. 77.297. Weil war an dem Umbau der Synagoge zu diesem Ort des Gedenkens beteiligt und dichtete den beklemmenden Text »Žalozpěv za 77297 obětí – Klagelied über 77.297 Opfer«. Er wurde 1959 in der Synagoge verlesen.
Der Text fügt Berichte, Augenzeugenberichte und biblische Zitate aneinander. Achtzehn Mal in der gleichen Reihenfolge. Erst 2000 erschien eine deutsche Übersetzung davon – leider wurde hier übersehen, dass ein wichtiges Element der Originalaushabe von 1958 die Gestaltung war. Die drei Textebenen waren hier horizontal und vertikal lesbar. Vertikal konnte man ihn als fortlaufenden Text vortragen und horizontal konnte man jeweils in einer »Schicht bleiben« und so alle Zeitzeugenberichte nacheinander lesen oder alle Bibelzitate nacheinander. Das könnte die Frage beantworten, aus welchem Grund Maxim Biller plötzlich (also jedenfalls unerwartet) ein Zitat aus dem Tanach seinem Text voranstellt. Ein Zitat aus dem Buch Kohelet (4,1): »Ich wandte mich um und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne.«
Warum also stellt Biller seinem Text ein Zitat aus Kohelet voran – und ausgerechnet in Luthers Übersetzung? Eine ironische Brechung? Eine Hommage an Weils Werk? Möglicherweise. Auch Weil hat diesen Text in sein Klagelied eingewoben und er entnahm die Zitate der Kralická-Bibel, der ersten Übersetzung der Bibel aus den Originalsprachen ins Tschechische, die im 16. Jahrhundert entstand – also keiner jüdischen Übertragung1. Das Klagelied begegnet den Lesern dann immer wieder in kleinen Szenen, die auch so dort geschildert werden: Jemand wird aus der Straßenbahn geworfen, ein Bote der Gemeinde übergibt die neuesten Verordnungen an jemanden, immer mehr Verordnungen folgen, die Märsche zum Radiomarkt. Hier werden die Texte von Weil und Biller verwoben. Das ist die zweite Ebene der Novelle und diese macht das Büchlein besonders. Es liegt nahe, dass es dazu anregt, sich mehr mit Jiří Weil zu beschäftigen und ihm so ein »Denkmal« gesetzt wird. Das hat er sich durch seine Arbeit bereits geschaffen und das nachhaltiger als ein Denkmal aus Stein. In der Novelle betrachtet Weil ein Monument von Stalin über der Stadt. Dort erkennt er Julius als Figur hinter dem riesigen Stalin. Julius nun für ewige Zeiten in Stein gemeißelt dort über der Stadt. Der Standort des Stalin-Monstrums ist heute der Standort eines großen Metronoms. 1955 offiziell enthüllt, wurde es schon 1962 wieder gesprengt. 1959 starb Weil. Seine Texte, wenngleich nicht mehr sehr populär, haben weiter bestanden. Sie sind noch immer eindrucksvoll. Dass Billers Buch kein Bestseller wird, aber ein Schlüsseltext sein könnte, ist wieder eine ironische Wende in der gesamten Geschichte. Das Büchlein ist in einer einmaligen (und gut ausgestatteten) Auflage von 2870 nummerierten Exemplaren. Mehr wird es nicht geben. Keine Massenware, sondern ein kostbares Stück Literatur – wie das Werk Weils. Also: Lesen, solange das Buch noch erhältlich ist.
Ach so: Das Buch beinhaltet auch Fotografien von Maxim Biller. Die schwarz-weißen Bilder zeigen Szenen von Prag.
Details zur ungewöhnlichen Edition
Die Buchhandelskooperation 5plus hat diese Edition verlegt und so eine Ware geschaffen, die nicht unmittelbar und unbegrenzt verfügbar ist. Wer das Buch möchte, muss sich an eine der Buchhandlungen wenden: Die Aegis Literatur Buchhandlung (Ulm), die Buchhandlung Klaus Bittner (Köln), die Buchhandlung Dombrowsky (Regensburg), Felix Jud GmbH & Co. KG (Hamburg), die Buchhandlung Lehmkuhl (München), die Buchhandlung Librium (Baden in der Schweiz), Schleichers Buchhandlung (Berlin) oder die Haymon Buchhandlung in Innsbruck (Österreich). Meine Ausgabe (zweistellige Nummerierung) stammt von der (freundlichen) Buchhandlung Felix Jud in Hamburg. Eine Bestellung war unproblematisch – allerdings nicht über den Shop. Interaktion war gefragt.
Maxim Biller Der unsterbliche Weil. Novelle, 80 Seiten, gebunden, € 18,80 - keine ISBN
Die einzige müsste von Rabbiner Gustav Sicher und Rabbiner Dr.Isidor Hirsch stammen und erst 1932 veröffentlicht worden sein. ↩︎