Diese Rezension hätte zur Frankfurter Buchmesse erscheinen sollen. Dann geschah der »siebte Oktober« und es erschien nicht angemessen, die Rezension zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Es war Zeit für »anderes«.
Fragen der jüdischen Identität
Was ist eigentlich jüdische Identität?
Die Frage nach der jüdischen Identität ist eine fortwährende Auseinandersetzung mit jüdischer Existenz. Vielleicht macht die Frage sogar einen guten Teil der jüdischen Identität aus?
Der Selbst-, oder Zirkelbezug ist offensichtlich, aber er existiert.
Was bestimmt jüdische Existenz im Jahre 5784?
Von einer besonderen Relevanz dieser Frage in Deutschland zu sprechen, scheint eine Floskel zu sein.
Auf der anderen Seite ist in den Identitätsdiskussionen der letzten Jahre eines immer wieder thematisiert worden: Die deutsche Gesellschaft ist auf der Suche nach »jüdischem Leben«. Zur Selbstvergewisserung und Selbstbestätigung. Die Protagonisten dieses jüdischen Lebens sollen Rollen einnehmen, wie sie dem Judentum vor der Schoa zugeschrieben werden: Intellektuelle. Nicht zu religiös. Verträglich religiös. Kritisch. Vorsichtig kritisch gegenüber dem Judentum (»sowieso gegen das Establishment«) und kritisch gegenüber der Gesellschaft – aber nicht zu kritisch. Eher wie unlustige Kabarettisten vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen lustig. Zwinker, zwinker, der jüdische Humor. Vielleicht kritisch gegenüber dem Staat Israel. Eine Haltung, die in Deutschland durchaus mehrheitsfähig ist. Oder überloyal gegenüber dem Staat Israel. Auch das wird in bestimmten Bubbles geschätzt. Niemand mag überfordernde Ausgewogenheit. Das betrifft die individuelle, aber auch die gesellschaftliche Ebene.
Und es sind die »public Jews«, die sich auf diesem Markt bewegen und sich – bewusst oder unbewusst – Projektionen aneignen, damit sie auffallen und gleich als jüdisch identifiziert werden. Jüdische Identität als Business-Model. Und wie das so auf dem freien Markt ist: Gegner der ersten Stunde sind Menschen, die ein ähnliches Feld bearbeiten. Namen könnte man hier einige einsetzen. Man könnte auch einen »Rabbiner« (der Einsatz der Anführungszeichen geschah hier durchaus bewusst) nennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein kompatibles »deutsches« Judentum zu bewerben, dass es so in Deutschland seit der Schoah gar nicht mehr gibt und damit offene Türen einlief. Eine ganze Kultur von »neuen Juden« ist dabei entstanden, die sich eher am imaginierten deutschen Ideal orientiert und weniger an den Werten, die in der restlichen jüdischen Welt beständig verhandelt werden.
Das tat er und das tun die »public Jews« für ein heimisches und nicht ein »hejmisches« Publikum (wer den Unterschied erkennt, ist Adressat dieser Rezension). Das Problem ist das Miteinander der Anhänger der »Public Jews« mit ihrem Idol. »Idol« kann hier dann auch in der Bedeutung gelesen werden, die das Wort eigentlich hat: Götze.
Das waren etwa 375 Wörter, ohne eines über das Buch von Deborah Feldman, das den Titel »Judenfetisch« trägt. Verhandelt »Judenfetisch« vielleicht jene Phänomene, die mit den »Public Jews« in Verbindung stehen?
Geht es in »Judenfetisch« um dieses Verhältnis zum »Jüdischen« in Deutschland, das man vielleicht und manchmal tatsächlich als »Fetischisierung« bezeichnen könnte? Jedenfalls in Bezug auf das Verhältnis der nichtjüdischen Seite auf die jüdische Community. In der Marktwirtschaft gibt es für jeden Bedarf einen Anbieter, der ihn kommerziell decken kann.
»Judenfetisch« ist kein Sachbuch, sondern beschreibt aus persönlicher Perspektive, wie Deborah Feldman Berlin und ihr neues soziales Umfeld erlebt und verarbeitet. Ihre Loslösung, ja die Flucht, aus der Gruppe der Satmarer hat sie bereits in Buch »Unorthodox« beschrieben. Bemerkenswert daran ist, dass sie sich nach ihrer Loslösung nicht gänzlich vom Judentum abgewandt hat, sondern sich weiterhin mit Fragen der jüdischen Identität auseinandersetzt, oder vielleicht »auseinandersetzen muss«. Wer Abstand zu Themen sucht, die mit jüdischer Identität zu tun haben, sollte vielleicht nach Dublin oder nach Biarritz ziehen und nicht nach Berlin. Bemerkenswert am Umgang mit »Unorthodox« in Deutschland war die Abwehrhaltung, mit der manche jüdische Leserinnen und Leser dem Buch begegneten. Als träfe die Kritik an den Satmarern zugleich die gesamte Community. Einige nichtjüdische Leserinnen und Leser hatten dann aber auch Probleme damit, die Satmarer von anderen »observanten« Gruppen zu trennen.
Die erzählerische Klammer bildet eine Reise nach Israel, insbesondere zu einer Veranstaltung von Yad Vashem. So blickt sie auf einen Ausschnitt der Situation in Israel und lässt dabei ihre jüdischen Begegnungen in Berlin Revue passieren. Sie begegnet einer Reihe von prominenten, öffentlichen, Jüdinnen und Juden und gibt Unterhaltungen und Situationen mit ihnen wieder. Kenner der Community werden schnell erkennen, wer etwa der Schriftsteller mit der dicken Brille ist, der den Sprung in die USA nicht geschafft hat. Herr B. taucht auf, einige Figuren der Berliner Bubble mit Klarnamen. Der Ton des Buches ist leicht zugänglich und routiniert. In diesem Ton wird die Leserin, wird der Leser, mit bemerkenswerten Überlegungen und Beobachtungen konfrontiert und Themen, aber auch Haltungen, wechseln schnell. So schildert Feldman, wie verheißungsvoll ihr Studenten des Abraham-Geiger-Kollegs erschienen, die sie in den USA kennenlernte. Sie verkörperten in diesem Moment, so Feldman, ein offenes Judentum, weil viele Konvertiten darunter gewesen seien. Ein »zugängliches« Judentum. Etwas später im Buch ist jedoch die Rede von »eigentlichen« Juden. Dieser Widerspruch wird nicht der einzige bleiben. Wenn das ein literarisches Mittel ist, dann spielt es gekonnt mit der Art, wie manchmal jüdische Texte funktionieren. Ein anderes Beispiel ist eine Szene, in der Feldman beschreibt, wie nah sie sich der arabischen Kultur fühlt und macht das an gewissen Eigenarten fest. Etwas, was wir in der Mitte des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Bereich als »Strömung« des Judentums finden konnten. Synagogen im »maurischen« Stil bildeten das architektonisch ab. Der »Orientalismus« erschien als natürliche Hinwendung zur eigenen Kultur. Einige Seiten später nimmt Deborah Feldman das tatsächlich auf (Seite 36): »…könnte man meine Sympathie als Fetischisierung verdächtigen: als klassisches Beispiel von Orientalismus, klar eingereiht in die vielen Ausdrucksweisen der westlichen Obsession mit dem Osten…«. Dieses arabische Umfeld ist natürlich ein Straßenzug in Berlin und weil Feldmans Lebensmittelpunkt Berlin ist, bewegen wir uns mit ihr in dieser Berliner »Szene«. Alles, was jenseits des Horizontes liegt, ist den Lesern nicht zugänglich.
Quantifizierungen und Feststellungen
Die persönliche Sicht ist – das liegt in ihrer Natur – subjektiv und lädt zum Widerspruch ein. Jedoch will der Text an der einen oder anderen Stelle mehr sein als persönliche Beobachtung. Eine Strategie, die häufiger im Buch zum Einsatz kommt, ist die Quantifizierung. Die Quantifizierungen sollen eine gewisse Objektivierung simulieren und Aussagen ein Gewicht verleihen.
»Es wird kein Zufall sein, dass der beliebteste Jude dieses Landes…« (Seite 175) wird in Bezug auf Michel Friedmann geschrieben und es offensichtlich, dass dies nicht stimmt. Kleiner Exkurs zu dieser These: Der beliebteste Jude dieses Landes? Ja, vermutlich noch immer Hans, »Hänschen«, Rosenthal. Aber Hans Rosenthal verdankte seine Popularität nicht der Tatsache, dass er Jude war.
An anderer Stelle (Seite 211) heißt es »auch für viele in der jüdischen Gemeinde Deutschlands schien diese Ansicht relevant.« Das ist schnell geschrieben, aber auch schlecht nachweisbar. Ebenso wie der folgende Satz: »Aber viele Juden in Deutschland sehen das anders, sie sind skeptisch.« (Seite 209) Quantifizierungen rufen dem Leser immer »Vorsicht« zu, es sei denn, sie werden mit Fakten aus Umfragen untermauert. Ähnlich skeptisch sollte man sein, wenn »Public Jews« von »wir« sprechen und damit die jüdische Community meinen. Niemand spricht für die gesamte Community.
Andere Aussagen sind »absolut« und gehen über die reine Beobachtung hinaus. Etwa auf Seite 132:
»Heute heißt Jude sein Opfer sein und Triumphierender zugleich. Juden sind einerseits eine diskriminierte Minderheit, andererseits eine politisch einflussreiche Macht.«
Erklärt wird nicht, wo diese Macht ausgeübt wird und letztendlich ist auch das eine Quantifizierung. Bisher scheint die »Macht der Juden« in den westlichen Staaten recht begrenzt zu sein, andernfalls müsste das Image des Judentums in diesen Staaten wesentlich besser sein. Und in Deutschland?
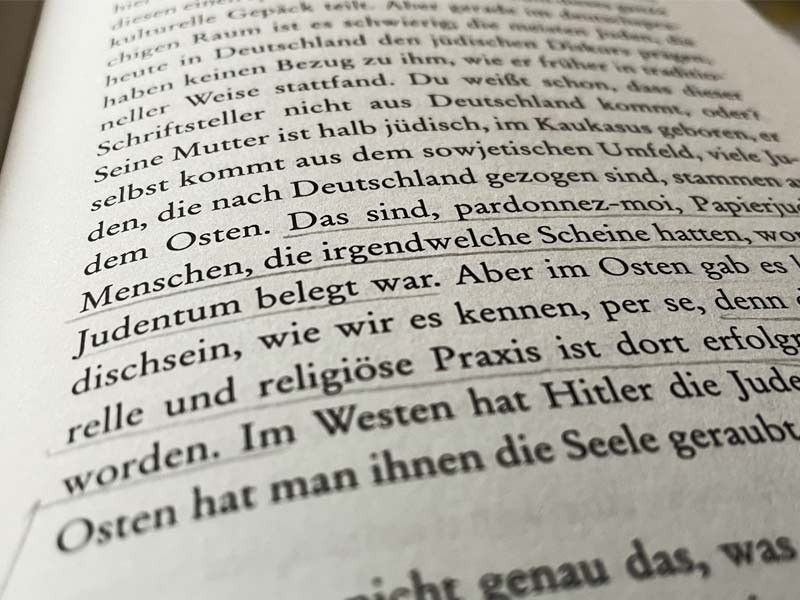
Lektorat und Begriffe
Autorin und Verlag wird klar gewesen sein, dass gerade dieses Buch von der jüdischen Community mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen werden würde. Deshalb ist es schwer nachvollziehbar, dass bekannte Begriffe oder Phrasen falsch wiedergegeben werden. Aus »LeSchana Haba'ah beJeruschalajim« wurde »La’shana haba-ah Yerushalayim« (also von englischen Transliteration abgesehen, fehlt hier eine Präposition und eine ist nicht korrekt) oder aus dem »Talmid Chacham« ein »Talmud Chacham« wurde. https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/talmid-chacham/ Oder der Tanach wird als die »gesamte Tora« bezeichnet (Seite 43). Die Zerstörung des Tempels (ab Seite 50), die auf »Sinat Chinam« zurückgeführt wird (im Buch aschkenasisch transliteriert als »Sinas Chinam«), also auf grundlosen Hass und damit die Ursache innerhalb der jüdischen Gesellschaft sieht und nicht externalisiert wird, wird auch behandelt. Aber interessanterweise aus nichtjüdischer Sicht:
»dieser grundlose, wuchernde Hass, der sich damals unter den Menschen breitgemacht hat, die sich eigentlich als Brüder hätten verstehen sollen, er soll also viel schlimmer als die Todsünden sein.« (Seite 50)
Da es die Todsünden im Judentum nicht gibt, ist das eine Referenz auf den Katholizismus. Der Umweg ist hier nicht klar. Letztendlich geht es um die explosive Stimmung in der Stadt Jerusalem, die für viele Gruppen innerhalb des Judentums und außerhalb des Judentums eine besondere Wichtigkeit hat und deshalb jeder Quadratzentimeter auch eine symbolische Bedeutung hat.
Ähnlich distanziert liest sich die Schilderung eines Schabbat-Gebets in der Berliner Pestalozzistraße. Möglicherweise ist dieser Teil auch eine Übersetzung aus dem Englischen (Seite 249): »Erst als man die Arche endlich öffnet«, die Männer tragen einen »Gebetsschal« und »danach entfaltet man die Rolle feierlich auf der Kanzel«. Der Text wirkt an dieser Stelle sehr nach einer Schilderung aus fremder Sicht. Aber dann überrascht er die Leserinnen und Leser mit neuen Fakten zur Torahlesung: »und wer das Hebräische selbst mit Hilfe schriftlicher Akzente nicht flüssig zu rezitieren vermag, erhält die Unterstützung eines Rabbiners, der stellvertretend für die Geehrten den Abschnitt gekonnt kantilliert.« Tatsächlich wird die Torah in der Regel »immer« von einem »Vorleser« (Ba’al Korej) gelesen. Natürlich sind das alles Kleinigkeiten, aber jüdische Leserinnen und Leser können schon irritiert sein.
Einer der Begriffe, mit denen es Probleme zu geben scheint, ist der Begriff der »Religion«, der auf das Judentum nicht zutrifft. So ist das Judentum ja viel mehr als Ritus und Halachah. Hier sieht Deborah Feldman Religion immer wieder gesondert und fragt sich: »Wenn es keine Religion mehr gibt, dann gibt es nur noch entweder Israel oder den Holocaust.« Ausgerechnet eine Gruppe, die in »Judenfetisch« nicht sonderlich positiv wegkommt, hat andere Erfahrungen gemacht. Die Jüdinnen und Juden der ehemaligen Sowjetunion habe ihre Zugehörigkeit zum »Judentum« bewahrt und mussten dies ohne Bezug zur Observanz der Halachah, zu Israel oder zur Schoah tun, denn die meisten Jüdinnen und Juden waren Angehörige der Befreier und das Andenken an die Schoah sollte in der Sowjetunion keine Angelegenheit einer »Nation« sein. Die Geschichte der Gedenkstätte von Baby Yar illustriert diesen Punkt eindrucksvoll.
An zwei Stellen wird der Autorin erzählt, es sei nicht selten gewesen, dass man in den Herkunftsstaaten Nachweise über die Zugehörigkeit zum Judentum gekauft habe. Übersehen wird hierbei, dass dies natürlich nicht die Regel war und wenn es doch geschah, dies nur deshalb getan wurde, um nach Deutschland kommen zu können – nicht, um sich hier mit einer jüdischen Identität in den Gemeinden oder der Politik hervorzutun. Die Jüdinnen und Juden, die kamen, waren die »Aufforster« jüdischen Lebens, ohne sich dieser Rolle bewusst zu sein. Sie bauten ihre Leben neu auf und investierten viel in die jüngsten Generationen. Diese wuchsen und wachsen als selbstbewusste Vertreter eines neuen jüdischen Lebens auf – oder wollen auch nichts mit den Gemeinden zu tun haben. Diese Gruppe steht allerdings nicht sonderlich im Fokus der nichtjüdischen Öffentlichkeit. Feldman kommt zu dem Schluss, dass es daran liegt, dass die Menschen keine Geschichte zur Schoah erzählen könnten. Vielleicht kann man jedoch auch in Betracht ziehen, dass sie sich der Definition der »Public Jews« entziehen, die zu Beginn dieser Rezension aufgestellt wurde.
Was ist mit dem Judenfetisch?
Das ist die eigentliche Überraschung. Diese Frage wird letztendlich nicht vollständig beantwortet. Nach einem Rundflug durch die Berliner Bubble haben wir viel über Menschen gelesen, aber kein vollständiges Bild. Wollten wir den Begriff mit Leben füllen, dann hätte das in letzter Konsequenz für das Buch bedeutet, dass es in einer Zuschauerbeschimpfung, nein Leserbeschimpfung, hätte münden müssen.
Warum, liebe nichtjüdische Leserin, warum lieber nichtjüdischer Leser, liest Du mein Buch? Warum interessierst Du Dich für mich?
Weil ich jüdisch bin?
Weil ich die Kriterien für eine öffentliche Jüdin erfülle?
Warum interessieren Dich innerjüdische Vorgänge so sehr?
Dieser selbstironische Dreh hätte dem Buch eine besondere Pointe gegeben.
Die ironische Brechung, dass Deborah Feldman selbst eine »öffentliche Jüdin« ist, die über andere »öffentliche Juden« schreibt und sich damit in diesen seit Jahren aufgeführten Reigen einreiht, wird im Buch leider nicht aufgegriffen. Natürlich werden es die Leserinnen und Leser zu schätzen wissen, wenn Feldman erklärt, warum sie Deutschland als Ziel ihrer Reise gewählt hat.
Eine stabile Gegenrede könnte nur jemand vorbringen, der nicht »öffentlicher Jude / öffentliche Jüdin« ist, weil er oder sie ansonsten selbst nur die eigene Position auf dem Markt verteidigen wollte – so könnte jedenfalls der Vorwurf lauten. Diese Person müsste aber Reichweite haben. Die hat sie aber nur als »Public Jew«. Der Widerspruch in sich ist deutlich. Und so laufen wir in einen weiteren Widerspruch im Zusammenhang mit diesem Buch und das ist schade, blockiert er doch eine handfeste Diskussion.
Der Talmud, der vermehrt Juden jeder Ausrichtung fasziniert, dokumentierte eine andere Kultur der Diskussion. Er präsentierte auch jene Sichtweisen, deren Vertreter als Häretiker oder »Aussteiger« galten. Man denke an »Acher« (Elischa ben Awuja) und seine faszinierende Geschichte.
Sich selbst zum Acher zu erklären, erzeugt vielleicht Aufmerksamkeit und Solidarität, aber vielleicht bedeutet es auch, dass man diesen Diskurs gar nicht will? Zuweilen wird im Buch angedeutet, die Autorin werde möglicherweise erkannt oder stehe mit ihrer Position im Abseits. Andererseits ist das Buch in hoher Auflage erschienen und erzeugt offenbar viel Resonanz.
Oder will man eine jüdische Diskussionskultur? Wäre das jüdische Identität?
Was bleibt nach der Lektüre von »Judenfetisch« für diejenigen, die sich für die jüdische Identität interessieren?
Eine Sicht und viel Abgrenzung. Aber auch das ist vielleicht typisch, sich dadurch abzugrenzen, was man alles nicht ist. In erster Linie scheint sich dieses Angebot jedoch an die nichtjüdische Mehrheit zu richten, die – ganz genau – auf der Suche nach einem »kompatiblen« Judentum ist (siehe die Einleitung). Erneut ein »Zirkelbezug.
